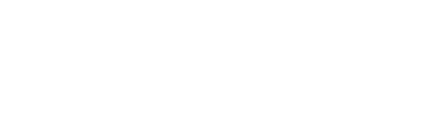Ukraine
Ukraine
Ukraine
Tetiana Katrychenko
Tetiana Katrychenko
Tetiana Katrychenko
Autorin und Aktivistin der Medieninitiative für Menschenrechte (MIHR)
Autorin und Aktivistin der Medieninitiative für Menschenrechte (MIHR)
Autorin und Aktivistin der Medieninitiative für Menschenrechte (MIHR)

Ukraine
Tetiana Katrychenko
Autorin und Aktivistin der Medieninitiative für Menschenrechte (MIHR)
„Wir müssen einen kritischen Blick beibehalten, Probleme ansprechen und Verstöße melden.“

VITA
Tetiana Katrychenko absolvierte ihr Studium am Institut für Journalismus an der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität Kiew und war bereits für die Zeitschrift Glavred und den Fernsehsender STB tätig. Zudem arbeitete sie für die Zeitungen Den, Ukrainska Pravda und Focus. Seit 2015 beschäftigt sie sich unter anderem mit der illegalen Inhaftierung ukrainischer Bürger auf dem Gebiet der Autonomen Republik Krim und des Donbass. Sie beteiligte sich an der Organisation von Advocacy-Kampagnen, die sich für die Freilassung von illegal inhaftierten Personen einsetzten. Sie ist Autorin der Berichte Military and civilian detainees in Donbas: searching for the efficient mechanism of release (Militärische und zivile Gefangene im Donbass: Suche nach einem effizienten Mechanismus zur Freilassung) und Female face of Donbas hostages (Das weibliche Gesicht der Geiseln im Donbass). Sie ist Mitglied der Kommission zur Prüfung von Fragen im Zusammenhang mit der Anerkennung von Personen, die infolge eines bewaffneten Angriffs auf die Ukraine ihrer Freiheit beraubt wurden, sowie zur Umsetzung von Maßnahmen zu deren sozialem Schutz.
Die Medieninitiative für Menschenrechte (MIHR) untersucht und dokumentiert Kriegsverbrechen und andere von Russland begangene Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine. Welche Ergebnisse konnten Sie bisher erzielen, und wie bewerten Sie die Auswirkungen Ihrer Arbeit?
Menschenrechtsarbeit ist ein Prozess. Uns ist klar, dass wir nicht in der Lage sein werden, die oberste Führung der Russischen Föderation und alle unmittelbaren Täter morgen oder übermorgen vor Gericht zu stellen. Doch als führende Organisation in diesem Bereich bleibt dies eines der Hauptziele der MIHR. Wir sind Mitbegründer der zivilgesellschaftlichen Koalition Ukraine 5 AM, die zum Schutz der Opfer von Aggressionen gegründet wurde. Zu Beginn der Invasion konzentrierten wir uns in erster Linie darauf, Verbrechen zu dokumentieren und die Welt über den Krieg zu informieren. Später rückte unsere analytische und anwaltschaftliche Arbeit in den Mittelpunkt. In den letzten drei Jahren haben wir Dutzende von analytischen Berichten über die Inhaftierung von Zivilisten, die Behandlung von Kriegsgefangenen, die Beobachtung von Gerichtsverhandlungen in der Ukraine und die Unterstützung der Familien von Vermissten verfasst. Außerdem haben wir Veranstaltungen im OSZE-Hauptquartier, im Europäischen Parlament, bei den Vereinten Nationen und im UN-Menschenrechtsrat organisiert und waren Mitorganisator der internationalen Konferenz Crimea Global: Understanding Ukraine through the South. Infolgedessen wurde uns die Ehre zuteil, von der niederländischen Regierung den Tulpenpreis für Menschenrechte und von der OSZE eine besondere Anerkennung für unsere Bemühungen um die Verteidigung der Demokratie zu erhalten. Ich sage immer "wir", denn wir können nur als Team erfolgreich sein. Unser Team ist unser größtes Kapital.
Ihr beruflicher Weg ist eine Synthese aus Journalismus und Menschenrechtsaktivismus. Wie gelingt es Ihnen, diese beiden Rollen in Ihrer Arbeit zu verbinden und von einem journalistischen Interesse zu einer tiefgreifenden Menschenrechtsarbeit überzugehen?
Ich habe den Journalismus seit meiner Studienzeit geliebt. Er wurde mein Leben - dynamisch, aufschlussreich und unendlich tiefgründig. Lange Zeit habe ich meine Arbeit bei einer der führenden gesellschaftspolitischen Wochenzeitungen des Landes erfolgreich mit dem Einsatz für die Menschenrechte kombiniert. Anfangs war mir wahrscheinlich nicht ganz klar, dass mein Wunsch, anderen zu helfen und sie zu unterstützen, tatsächlich Teil eines umfassenderen Anliegens war, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Rechte wahrzunehmen und Rechtsverletzungen zu verhindern. Irgendwann wurde mir jedoch klar, dass es nicht mehr ausreichte, nur von der Seitenlinie aus zu beobachten und Berichte zu schreiben. Ich musste handeln und für andere kämpfen. Im letzten Herbst traf ich die schwierige Entscheidung, mich aus der Redaktion zurückzuziehen, um mich mehr der Menschenrechtsarbeit zu widmen. Heute schreibe ich nur noch gelegentlich für die MIHR-Website, um in Form zu bleiben.
Gibt es eine persönliche Geschichte, vielleicht von einer Person oder einer Familie, die Sie tief berührt hat? Eine Geschichte, die zu einem Symbol dafür geworden ist, warum es sich lohnt, für Gerechtigkeit zu kämpfen, auch wenn es schwierig ist oder hoffnungslos erscheint?
Ich habe einen Freund, Bohdan. Wir haben uns zum ersten Mal in Abwesenheit "getroffen", etwa ein Jahr nachdem er in der Nähe des Flughafens von Donezk gefangen genommen wurde, als er die Ukraine verteidigte. Zuerst lernte ich seine Frau und seine Eltern kennen – ich arbeitete gerade an einer Geschichte. Dann blieben wir in Kontakt. Als Bohdan nach fünf Jahren Gefangenschaft freigelassen wurde, wussten wir bereits eine Menge übereinander. Seine Frau hatte mich immer wieder in ihren Briefen an ihn erwähnt und nannte mich "die Journalistin". Am stärksten fiel mir auf, dass Bohdan selbst nach fünf Jahren nicht zusammenbrach. Er verfiel nicht in Depressionen oder gab sich der Verzweiflung hin – und seine Frau auch nicht. Heute ist sie Teil des MIHR-Teams. Ihre schwierigen persönlichen Erfahrungen helfen ihr, andere besser zu verstehen und noch wirkungsvoller zu arbeiten.
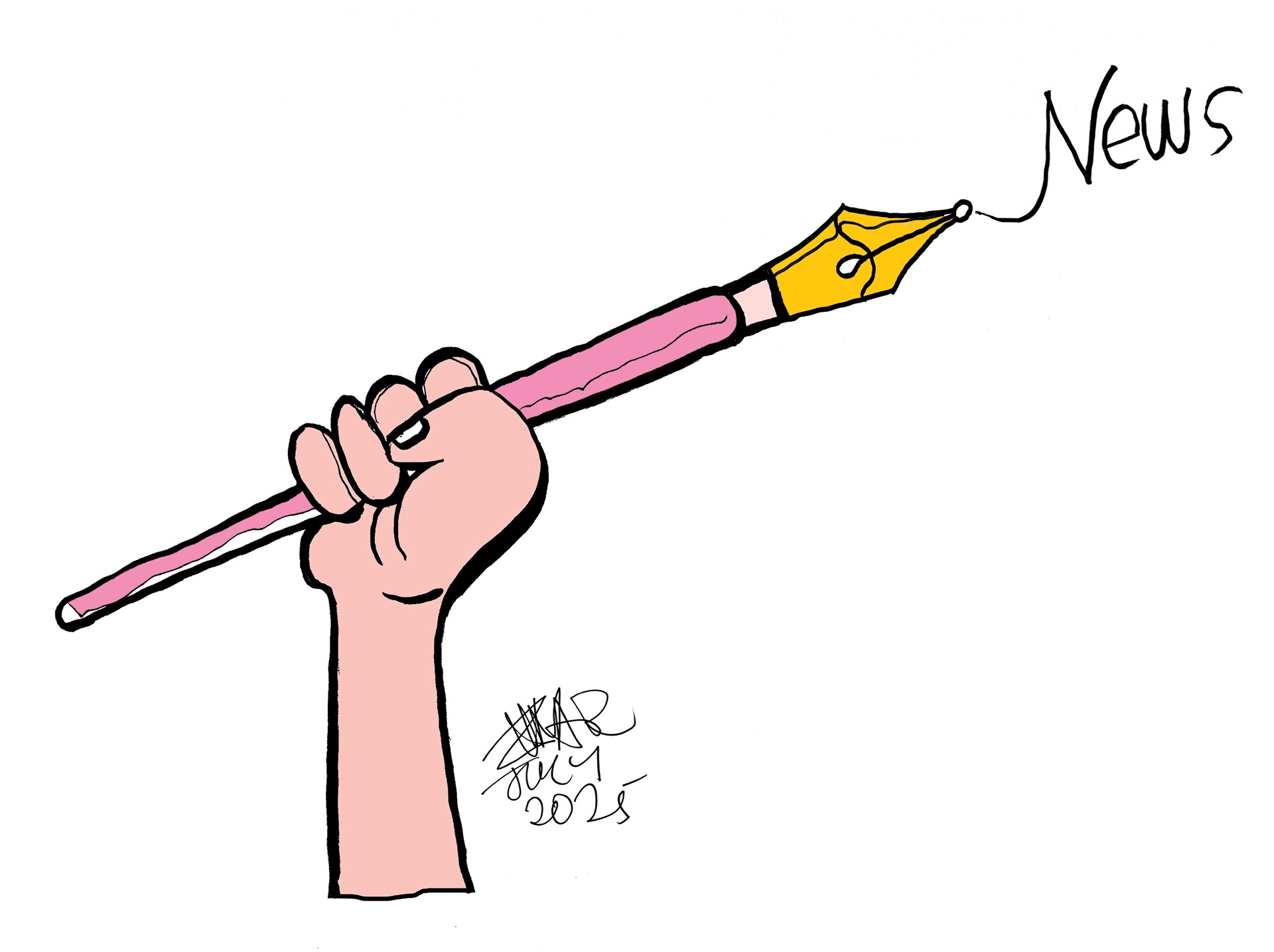
Menschenrechtsaktivitäten in Kriegszeiten sind oft mit großen Risiken verbunden. Vor welchen Herausforderungen stehen zivilgesellschaftliche Organisationen, die unter solchen Bedingungen arbeiten?
Es gibt verschiedene Arten von Risiken. Einige betreffen unser Leben – wir arbeiten in unbesetzten Siedlungen, oft direkt nach der Befreiung, oder in der Nähe der Frontlinie. Ich habe immer kugelsichere Westen und einen Helm im Kofferraum meines Wagens. Außerdem besteht die Gefahr eines psychischen Burnouts. Das menschliche Leid, dem wir begegnen, kann überwältigend sein. Manchmal hat man das Gefühl, zu ersticken. Ich glaube, am meisten hilft der Humor. Es kann auch passieren, dass man zynisch wird. Das größte Risiko ist vielleicht, nicht gehört zu werden. Organisationen der Zivilgesellschaft sind oft Partner des Staates, insbesondere wenn sie internationale Verbrechen dokumentieren. Der Staat kann das einfach nicht allein bewältigen. Wir können jedoch weder Teil der Regierung werden, noch können wir als Dienstleister für sie fungieren. Wir müssen einen kritischen Blick beibehalten, Probleme ansprechen, Verstöße melden, unabhängig von Kooperationen oder Partnerschaften. Und wo der Staat in Kriegszeiten nicht immer die Zeit hat, Lösungen zu entwickeln, versuchen wir, unsere eigenen anzubieten. Beispielsweise hat die Russische Föderation Tausende von Zivilisten aus den besetzten Gebieten entführt und sie in Gefängnisse geworfen, wo sie ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten werden. Es gibt keinen bestehenden Mechanismus, um sie dort herauszuholen. Die MIHR hat dazu einen Vorschlag unterbreitet und der Staat – das Präsidialamt, das Büro des Ombudsmanns, die Koordinationszentrale und andere – haben zugehört. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an einem Aktionsplan und konkreten Schritten.
Wurden Sie oder Ihr Team aufgrund Ihrer Arbeit unter Druck gesetzt, eingeschüchtert oder auf andere Weise behindert?
Im Krieg geht es um Emotionen, die oft schmerzhaft und voller Frustration sind. Ich habe negative Äußerungen gehört, aber keine direkten Drohungen. Die einzigen wirklichen Drohungen oder "Warnungen", die ich erhalten habe, standen im Zusammenhang mit der Aufdeckung unbequemer Fakten in meiner Arbeit als Journalistin, und nicht mit meiner Menschenrechtsarbeit.
Angesichts der schrecklichen Aggression Russlands, der Folter, des Verschwindenlassens von Menschen und der unmenschlichen Behandlung ukrainischer Zivilisten durch die russische Armee ist Ihr Einsatz sehr wichtig. Welche Unterstützung erwarten Sie von internationalen Entscheidungsträgern?
Wir wenden uns auch an die internationale Gemeinschaft. Am 16. Juni debattierte das Europäische Parlament über einen Entschließungsentwurf mit dem Titel "Die menschlichen Kosten des russischen Krieges gegen die Ukraine und die dringende Notwendigkeit, die russische Aggression zu beenden: die Situation illegal festgehaltener Zivilisten und Kriegsgefangener und die anhaltende Bombardierung von Zivilisten". Das Dokument verurteilt Russlands massenhafte willkürliche Inhaftierungen, Folter, erfundene Anklagen und unmenschliche Haftbedingungen. Während der Debatte erwähnten mehrere Abgeordnete – darunter Petras Auštrevičius aus Litauen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus Deutschland - konkrete Fälle, wie den des ukrainischen Journalisten Dmytro Khyliuk oder von Kateryna Korovina, einer Zivilistin aus der Region Luhansk, die inhaftiert wurde, weil sie an Freiwilligengruppen gespendet hatte, die das Militär unterstützen. Dies ist eine Art Sieg. Ein Sieg in Bezug auf die Ausübung echten Drucks auf die Russische Föderation. Jetzt werden von der Tribüne des Europäischen Parlaments wieder Anschuldigungen gegen Russland und Forderungen nach der Freilassung von Ukrainern laut.
Russland zieht es vor, Verbrechen hinter verschlossenen Türen zu begehen. Internationale Beobachtermissionen und humanitäre Organisationen haben schon lange keinen Zutritt mehr zum Land. Wenn die Öffnung jedoch erzwungen werden kann, wird es schwieriger, weiterhin im Stillen Gewalt zu verüben. Wenn dieser Druck weiter wächst – und wir zählen darauf, dass die internationale Gemeinschaft und die politischen Führer dafür sorgen, dass dies passiert – könnte Russland seine Menschenrechtsverletzungen zumindest teilweise einstellen. Es könnte damit beginnen, einige der entführten Zivilisten freizulassen - Menschen, für die wir uns aktiv einsetzen. Wir erwarten auch die feste Überzeugung, dass die Gerechtigkeit siegen muss. Die Täter - ob in Russland oder bei seinen Verbündeten wie Nordkorea und Belarus - müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Europa muss in dieser Hinsicht standhaft bleiben: Verschärfung der Sanktionen und Beschlagnahme von Vermögenswerten.
Ukraine