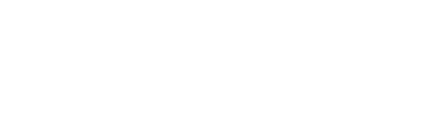Russland
Russland
Russland
Irina Scherbakowa
Irina Scherbakowa
Irina Scherbakowa
Historikerin, Autorin und Menschenrechtsverteidigerin
Historikerin, Autorin und Menschenrechtsverteidigerin
Historikerin, Autorin und Menschenrechtsverteidigerin

Russland
Irina Scherbakowa
Historikerin, Autorin und Menschenrechtsverteidigerin
„Heute wie damals entsteht Hoffnung aus demselben Grund: aus der Erinnerung, aus dem Aussprechen der Wahrheit, aus dem Dialog. Selbst wenn alles düster scheint, ist es wichtig, weiter zu reden, zuzuhören und zu dokumentieren.“

VITA
Irina Scherbakowa ist Historikerin, Autorin und Menschenrechtsverteidigerin. Sie zählte 1988 zu den Mitbegründern von Memorial. Sie wurde 1949 in Moskau geboren, schloss ihr Studium an der Staatlichen Universität Moskau ab und promovierte in Philologie. In den späten 1970er begann sie, mündliche Erzählungen von ehemaligen GULAG-Häftlingen zu sammeln und legte damit den Grundstein bei Memorial für die Dokumentation sowjetischer Repressionen. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR verband Memorial seine Menschenrechtsarbeit mit historischer Bildung. Im Jahr 2014 bezeichnete der russische Staat die Organisation als "ausländischen Agenten". Im Jahr 2021 wurde Memorial durch den Obersten Gerichtshof Russlands geschlossen. Kurz darauf wurden Mitglieder wegen angeblicher "Rehabilitierung des Nazismus" und Verfälschung der sowjetischen Geschichte strafrechtlich belangt, was zeigt, wie bedrohlich diese Erinnerungsarbeit für Putins Regime wirkt. Im Jahr 2022 erhielt Memorial zusammen mit dem weißrussischen Aktivisten Ales Bialiatski und dem ukrainischen Zentrum für bürgerliche Freiheiten den Friedensnobelpreis. Für Memorial bestätigt diese Anerkennung die zentrale Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit stalinistischer Unterdrückung, staatlicher Gewalt und historischen Lügen unerlässlich ist. Ohne die Aufarbeitung der Verbrechen sowohl des sowjetischen als auch des Putin-Regimes kann es keine Grundlage für Gerechtigkeit, Demokratie und Vertrauen geben. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Geschichte hilft, zukünftige Gewalt und Autoritarismus zu verhindern. Bis 2022 leitete Irina die Bildungsarbeit von Memorial in Russland. Im Exil in Deutschland setzt sie diese Arbeit fort und ist Mitbegründerin von Memorial Zukunft. Sie prangert öffentlich das Regime Putins und den Krieg in der Ukraine an.
Was hat Sie dazu bewogen, Interviews mit ehemaligen GULAG-Häftlingen zu sammeln?
Normalerweise möchte die nächste Generation etwas über die Kindheit ihrer Eltern erfahren. In meiner Familie überschnitt sich diese Kindheit der Eltern mit einem der dunkelsten Kapitel der russischen Geschichte – den 1930er Jahren und den Jahren des Massenterrors. Ich wuchs inmitten von Menschen auf, die diese Zeit überlebt hatten. Viele andere hatten nicht überlebt. Meine eigene Familie überlebte durch eine seltsame Fügung des Schicksals. Mein Großvater arbeitete für die Kommunistische Internationale (Komintern) und fast alle seine Kollegen wurden umgebracht. Aber er überlebte. Ich wuchs mit dieser Geschichte auf und verstand zunächst nicht ganz, warum alle immer wieder sagten: "Wir hatten so viel Glück." Irgendwann wurde mir klar, wie wichtig es war, darüber zu sprechen. Die Leute erzählten mir Dinge, die sie noch nie laut ausgesprochen hatten. Für sie war das eine Erleichterung. Und für mich war es die Erkenntnis, dass es nicht nur um persönliche Geschichten ging, sondern um etwas viel Größeres. Es war eine Geschichte, die es nie in die offiziellen Lehrbücher geschafft hat.
Was macht Putins Regime heute aus?
Der Kern von Putins postmoderner Ideologie ist in einer verklärten Version der Vergangenheit verwurzelt. Es handelt sich um eine eklektische Form des Traditionalismus: eine Mischung aus vagen philosophischen Bezügen, Eurasismus und faschistoiden Ideen. Anfangs war diese ideologische Verquickung verwirrend, aber mit der Zeit hat sie sich zu einem militanten Ultrakonservatismus mit eindeutig faschistischen Zügen verfestigt. Die Aggression gegen die Ukraine wurde mehr als jeder andere Krieg durch diese historischen Narrative gerechtfertigt, die als Wiederherstellung der so genannten "historischen Gerechtigkeit" dargestellt wurden. Was den heutigen russischen Staat noch beängstigender macht als die Sowjetunion, ist seine offene Bejahung von Gewalt. Bei aller Brutalität versuchte das Sowjetregime, Folter, Hinrichtungen und die Lager zu verbergen. Es tarnte seine Verbrechen mit Lügen. Das heutige Regime tut das Gegenteil. Die Gewalt wird zur Schau gestellt. Sie wollen, dass wir Angst haben. Folter ist zur Normalität geworden, Repression ist die Regel. Die Menschen wissen, dass Polizeifolter vorkommt und dass es jeden treffen kann. Glauben Sie mir, es gibt keine wirksamere Methode, einer Bevölkerung Angst einzuflößen.
Was bedeutet der Krieg gegen die Ukraine für Sie?
Er ist eine Katastrophe für Russland und für die russische Gesellschaft. Und der Krieg ist ein entsetzliches, unvorstellbares Verbrechen an der Ukraine. Mir wurde klar, dass ich, wenn ich überhaupt noch von Nutzen sein kann, dies nicht mehr innerhalb Russlands tun kann. Im Exil kann ich sprechen und werde gehört. Putin hat es nicht geschafft, die Ukraine zu erobern und zu unterwerfen. Das gibt uns Hoffnung. Unsere Kollegen von Memorial arbeiten eng mit ukrainischen Partnern zusammen, um russische Kriegsverbrechen in der Ukraine zu dokumentieren. Das ist eine schwierige professionelle Arbeit. Wir haben bereits Erfahrungen aus Tschetschenien und wissen, wie schwer es ist, die individuelle Verantwortung für solche Verbrechen nachzuweisen. Wir unterstützen diese Bemühungen, so gut wir können. Diese Arbeit ist nicht nur für die Ukraine wichtig, sondern auch für die Zukunft Russlands, wenn sich das Land einmal ehrlich im Spiegel betrachten muss.

Wie sieht Ihre Arbeit heute aus?
Wenn man mich fragt, was ich mache, sage ich: Ich bin Lobbyistin (für Menschenrechte). Ich erkläre Politikern, Journalisten und der Öffentlichkeit, was das Putin-Regime ist. Ich spreche oft in Ostdeutschland, vor allem dort, wo die Wahlergebnisse beunruhigend sind. Ich sehe es als meine Aufgabe an, den Menschen zu vermitteln, was passieren könnte. Ich fordere sie auf, sich an ihre reale statt an eine nostalgische Geschichte zu erinnern, und ich warne vor den Gefahren des Putin-Regimes und den Illusionen eines einfachen und schnellen Friedens in der Ukraine. Wir arbeiten seit langem mit deutschen Stiftungen, Historikern und Museen zusammen. Ich glaube, wir stehen für Hoffnung und zeigen, dass es ein anderes Russland gibt. Das ist nicht nur für uns wichtig, sondern auch für die deutsche Gesellschaft. Wenn ich über Putins Regime oder die Schrecken des Krieges spreche, finden meine Worte vielleicht mehr Resonanz beim deutschen Publikum, insbesondere bei jenen, mit denen ich direkt sprechen kann. Trotz begrenzter Mittel leisten wir als Experten mit Ausstellungen, Vorträgen und Kulturarbeit weiterhin unseren Beitrag, insbesondere in Ostdeutschland. Das ist kein Zufall: Uns verbindet eine gemeinsame totalitäre Vergangenheit und die harten Lehren des 20. Jahrhunderts. Deutschland ist ein Ort, an dem die Mission von Memorial weiterleben kann.
Spielt die Emigration aus Russland heute eine politische Rolle, und wie sieht ihre Zukunft aus?
All das Gerede darüber, dass diejenigen, die gegangen sind, keine Rolle mehr spielen - das ist einfach nicht wahr. Willy Brandt zum Beispiel war während des Krieges nicht in Deutschland. Er ist erst nach 1945 zurückgekommen und hat die deutsche Politik trotzdem weiter geprägt. In diesem Sinne ist unsere Aufgabe vielleicht sogar einfacher: das fortzusetzen, was Memorial schon immer getan hat, nämlich die Erinnerung zu bewahren, Verbrechen zu dokumentieren, Menschenrechtsverteidiger zu unterstützen und mit der Gesellschaft zu sprechen. Das Exil ist nicht das Ende, es ist ein Weg, um weiterzumachen. Es hat sogar noch an Bedeutung gewonnen. Und warum? Weil in Russland der Raum für offenen Widerstand rapide schrumpft. Es gibt immer weniger öffentliche Standards und immer weniger Möglichkeiten, sich frei zu äußern. Unsere Kollegen und Freunde, die in Russland geblieben sind, tun trotzdem weiterhin, was sie können: Sie schreiben, antworten ehrlich auf Fragen und forschen, soweit das noch möglich ist.
Was hilft Ihnen heute, die Hoffnung aufrechtzuerhalten?
Wissen Sie, in den späten 1970er Jahren schien alles hoffnungslos. Die Dissidentenbewegung war zerschlagen worden, Menschen saßen in Gefangenenlagern, und der Krieg in Afghanistan hatte begonnen. Es schien, als sei das System, auch wenn es poststalinistisch war, immer noch starr und undurchdringlich, und als würde sich nie etwas ändern. Selbst die Aussicht auf Breschnews Tod gab keinen Anlass zur Hoffnung. Zu dieser Zeit durchlebte ich eine schwere persönliche Krise. Und dann rettete mich genau die Arbeit an den Interviews, die Gespräche mit ehemaligen Häftlingen und das Hören ihrer Erinnerungen. Das gab mir einen Sinn und eine Richtung. Heute wie damals entsteht Hoffnung aus demselben Grund: aus der Erinnerung, aus dem Aussprechen der Wahrheit, aus dem Dialog. Selbst wenn alles düster scheint, ist es wichtig, weiter zu reden, zuzuhören und zu dokumentieren. Das ist es, was uns vor der Verzweiflung bewahrt.
Russland